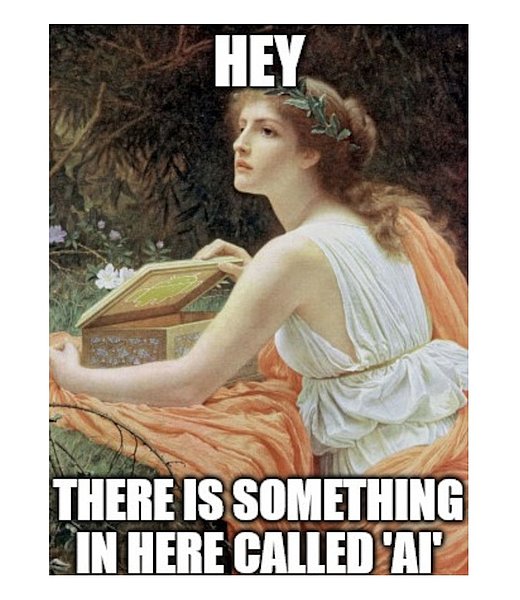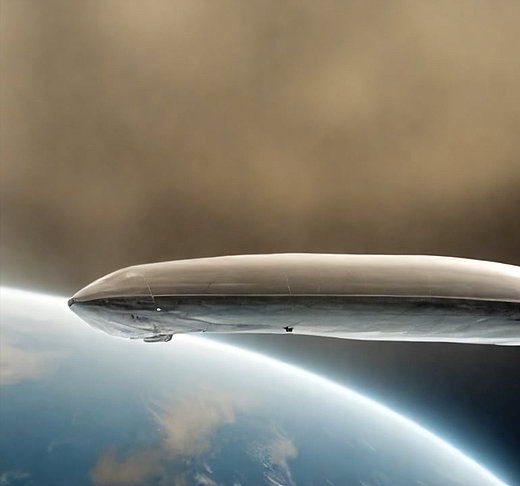Der internationale Museumsverband ICOM bietet in Form der ICOM Museumsdefinition und der Ethischen Richtlinien Orientierung. Erstere wurde nach intensiven internationalen Diskussionen auf der ICOM Generalkonferenz 2022 bestätigt, Letztere befindet sich aktuell in einem internationalen Diskursprozess.
KI und gefühlte Wahrheiten im Museum
von Dominik Busch
September 2025
Eine neue Kultur der Digitalität hat die Museen erreicht und sie ist nichts weniger als ein Gamechanger. Künstliche Intelligenz wird kulturelle Infrastrukturen grundlegend verändern, aller (in Teilen berechtigten) Kritik an ihr zum Trotz. Die Potenziale von KI im Museum reichen bereits heute von Sammlungs- und Datenbankanwendungen (Indexierung, Bilderkennung) zu Ausstellungsgestaltung und Besucher:innenforschung (Heatmaps, Leitsysteme, Umfragen), über KI-gestützte Gebäudeüberwachung hin zu Personalmanagement und Kommunikationsprozessen (Textgenerierung, SEO-Optimierung, CRM), Vermittlung (Audiogeneratoren für Apps, adaptive sprechende Labels) und Community Engagement. [1] In der Diskussion um KI sind neben datenschutzrechtlichen und Nachhaltigkeitsfragen solche um die Vorgehensweisen privatgesellschaftlich verwalteter Large Language Models (LLMs) und deren Trainingsdaten sehr präsent. Es geht um den Missbrauch von Open Source, um Bias und Monopolstellungen. Die ethische Dimension in dieser Diskussion scheint mir jedoch aktuell die akuteste zu sein. Denn im Rahmen ethischer Standards von Museen stellen sich Fragen nach Verantwortung nicht nur im Umgang mit Sammlungs- und Besucher:innendaten, sondern meiner Meinung nach vor allem im Kontext der Vermittlung und Kommunikation, die ein verändertes Selbstverständnis notwendig machen.
2024 erschien eine Studie des Instituts für Museumsforschung[2], nach der Museen der Familie, den Freund:innen, der Presse und der Wissenschaft den ersten Rang als vertrauensvollste Informationsquelle abgelaufen haben. Das kann man skeptisch sehen, berechtigt oder erfreulich finden, die Begründung ist in jedem Fall eine nähere Betrachtung wert: Das hohe Vertrauensniveau ergibt sich nämlich nicht etwa aufgrund der unabhängigen wissenschaftlichen Forschung oder professionellen Standards, die in Museen gelten, sondern aufgrund einer Wahrnehmung von Museen als “neutral“. Neutral haben Museen aber allein in parteipolitischer Hinsicht zu sein, auf vielerlei anderen Ebenen sind sie Teil eines komplexen Systems aus Kontinuitäten und Abhängigkeiten. Sie reproduzieren unzweifelhaft gesellschaftliche Machtstrukturen, sei es in ihrer Organisation, ihrer Personalstruktur, ihren Sammlungen, ihrem Zugang oder ihrer Finanzierung. Wir wissen aus Geschichte und Gegenwart, dass ihr Vertrauensniveau missbraucht wird, wenn sie zum Austragungsort politisch motivierter Geschichtskonstruktionen und so ideologisch instrumentalisiert werden. Museen sind Orte der Repräsentation, sie ordnen und konservieren, sie vermitteln, sie schaffen Realitäten. In einem Satz: Museen sind Orte der Macht, sie können nicht „neutral“ sein. Deswegen tragen sie eine besondere Verantwortung und spielen eine zentrale Rolle in der Aushandlung und Gestaltung von Gesellschaften.
Werden Museen aber in diesem erweiterten Sinne als “neutral“ wahrgenommen, werden ethische Standards und Haltungen aus ihrer Arbeit herausgelesen. So avanciert die museale Vermittlung in Konsequenz zur Vermittlung einer subjektiven, einer gefühlten „Wahrheit“. Das ist nicht nur im Spannungsfeld wissenschaftlicher Autonomie und politischer Einflussnahme eine ebenso gefährliche wie falsche Annahme, sondern ignoriert jene hinlänglich bekannten Machtkontexte. Zugespitzt ließen sich daraus zwei theoretische Schlussfolgerungen ziehen. Erstens: Museen verfügen über keinen Raum für Fehler, da das ihnen entgegengebrachte, auf subjektiver Neutralitätswahrnehmung fußende Vertrauen sonst erschüttert wird. Derart lassen sich beispielsweise Attacken auf Museen lesen, wie etwa Empörungen über Safe Spaces, Kunst auf Damentoiletten, Regenbogenfahnen auf Museumsdächern oder gendergerechte Sprache. Ergo, der Spielraum für Haltungsbekundungen und Experimente schrumpft. Zweitens – und das ist noch gravierender: Menschen sind es entweder nicht gewohnt oder sie sind nicht dazu fähig, ihre subjektiven, gefühlten Wahrheiten zu hinterfragen. Stattdessen vertrauen und beharren sie. Das ist im Zeitalter von KI, der (bild-)mächtigsten Technologie der Menschheitsgeschichte, ein Riesenproblem, denn es deutet auf eine Unfähigkeit zur Unterscheidung zwischen Fakt und Fake.[3]
1994 postulierte der Kunsthistoriker und Philosoph Gottfried Boehm den iconic turn, die „Verlagerung von der sprachlichen auf die visuelle Information, vom Wort auf das Bild und (…) vom Argument auf das Video“ wie Willibald Sauerländer es beschrieb. Diese erstaunlich gegenwärtige Beschreibung trifft heute auf nahezu jedes Medium zu: Denn digitale Medien, soziale Netzwerke, das Internet und Smartphones sind sogenannte Metamedien.[4] In Metamedien kommt zusammen, was ehemals getrennt und überwacht war: Medienproduktion, Medienmanipulation und Medienverbreitung. Metamedien sind Gegenstand, Inhalt und Medium in einem. Einerseits ordnen sie Primärmedien, machen sie so zugänglich und stellen Diskurszusammenhänge her, andererseits verdichten sie komplexe Inhalte zusätzlich durch deren Reproduktion, Kommentierung und Veränderung. In diesem Sinne haben Metamedien viel mit Museen gemein, erst recht vor dem Hintergrund der neuen ICOM Museumsdefinition.
Mit dem publiken Auftreten von KI und speziell generativer KI tritt uns nun ein radikal Anderes entgegen, das der Medienproduktion, -rezeption und -vermittlung ebenso große Potenziale aufzeigt wie es sie vor Herausforderungen stellt. Denn KI generiert Bedeutung ohne menschlich-existentielle Bedingungen. Zwar wird KI anhand menschlicher Artefakte trainiert und macht sie der menschlichen Umwelt so verwandt; sie ist aber je alles by-proxy. Auch diese Stellvertreterfunktion ist dafür verantwortlich, dass KI halluziniert oder falsche kausale Ketten knüpft. Denn die KI lernt menschliche Ordnungssysteme, bringt aber deren Ausnahmen und Sonderregelungen nicht überein. Das System Fußnote ist berechenbar, ob die genannte Quelle aber faktisch korrekt ist, nicht. Die Fußnote ist da, Auftrag erfüllt. KI kann so auch als Metamedium gelesen werden: Sie ordnet, macht zugänglich und stellt Zusammenhänge her, sie verdichtet, reproduziert und verändert. Sie tut das aber alles je by-proxy und kann deswegen auch nicht zwischen Fakt und Fake unterscheiden.
Diese Unfähigkeit multipliziert die eingangs beschriebene Verantwortung von Museen. Es gilt zu verhindern, dass KI im Museum zu einer Mise en abyme wird, einem Bild im Bild, das Bedeutung nur noch rekursiv konstruiert. Dazu gilt es neben allgemein regulativen Maßnahmen vor allem die Kompetenzen von User:innen und Provider:innen gleichermaßen zu steigern: Bildkompetenz, Digitalkompetenz, Medienkompetenz. Zahlreiche Studien belegen, dass es hier deutlichen Nachholbedarf gibt. [5] Deswegen realisieren Museen und andere Bildungseinrichtungen bereits Projekte, Formate und Kampagnen, die explizit die Steigerung dieser digitalen Kernkompetenzen zum Ziel haben. Deswegen erarbeiten Museen Leitlinien für einen ethischen Einsatz von KI, deswegen experimentieren Museen mit KI-basierten Diskursformaten. Der SWR veröffentlichte beispielsweise den Fakefinder, der spielerisch Quellenanalyse und -einordnung im Internet vermittelt. Die Bundeszentrale für politische Bildung klärt zielgruppengerecht und plattformadäquat auf TikTok über Deepfakes auf. Auch die Bildungsstätte Anne Frank, CeMAS und andere liefern wertvolle Beiträge durch digitale Lernlabore, Workshops, Recherchen, empirische Analysen und Faktenchecks.
Es ist eine zentrale Aufgabe von Kultur- und Bildungsinstitutionen, die Fähigkeiten aller im Umgang mit (digitalen) Medien zu stärken, speziell im Umgang mit (generativer) KI. Sie müssen die „demokratisierte Bildmacht“ von KI innovativ und verantwortungsvoll zu nutzen beginnen.[6] Neben einer Kennzeichnungspflicht KI-generierter Inhalte und Faktenchecks auf offiziellen Kanälen wäre es (zusätzlich) sozial nachhaltiger, Medienkompetenz als verpflichtendes Schulfach einzuführen.[7] Denn nur wer Medien richtig lesen und kritisch reflektieren kann, kann an gesellschaftlichen Prozessen teilhaben. Als gesellschaftsbildende Akteure betrifft das auch die Museen selbst: Um ihrem Bildungsauftrag nachkommen und ein neues Selbstverständnis entwickeln zu können, müssen Museen selbst medienkompetent werden und Gelerntes verlernen. Diese Fähigkeit der Anpassung ist nicht nur angesichts KI als radikal Anderem notwendig; es sind resiliente Gesellschaften, Gesellschaften die sich in einem Zirkel des Unlearning befinden, die zukunftsfähig sind. Unlearning fordert dazu auf, selbstverständlich erscheinende „Wahrheiten“ infrage zu stellen und alte zu verlernen. Verlernen bedeutet dabei nicht, Dinge zu vergessen oder gar auszulöschen, sondern hegemoniales Wissen und eingeübte Praktiken zu überdenken und sich mit Nichtwissen, Unwissen und Nichtverstehen auseinanderzusetzen. Der Konzeptkünstler Mel Bochner drückte es so aus: „definitions are phenomena“. So könnten Museen ihrer Verantwortung als gesellschaftliches Metamedium, als Ort des Diskurses, als demokratiefördernde Institution gerecht werden.
[1] Für eine Einführung empfehle ich Sonja Thiel, Johannes Bernhard (Hrsg.), AI in Museums, transcript 2023. Sowie AI: A Museum Planning Toolkit des Museums+ AI Network: https://themuseumsai.network/toolkit/ (Zugriff 21.08.2025)
[2] Kathrin Grotz und Patricia Rahemipour, Das verborgene Kapital: Vertrauen in Museen in Deutschland. Wie die Menschen in Deutschland auf eine Kultureinrichtung im Wandel blicken. Eine bevölkerungsrepräsentative Studie des Instituts für Museumsforschung – Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin 2024. Zenodo, https://doi.org/10.5281/zenodo.13981575 (Zugriff vom 7.04.2025). Die Studie liefert wertvolle Analysen, lässt aber eine begriffliche Unschärfe zwischen „Vertrauen“, „Wahrheit“ und „Neutralität“ ungeklärt.
[3] Sprachwissenschaftlich hat Susanne Flach sechs Dimensionen des Begriffs „Fake“ nachgezeichnet. „Gefühlte Wahrheiten“ ließen sich am Ehesten in die „Schein“-Gruppe einordnen (https://www.sprachlog.de/2014/01/06/kandidaten-fuer-den-anglizismus-2013-fake/ (Zugriff vom 21.08.2025).
[4] Helmut Schanze und Manfred Kammer (Hrsg.), Interaktive Medien und ihre Nutzer, Bd. 3, Metamedien, Baden-Baden 2001.
[5] Vgl. https://www.ard-zdf-medienstudie.de/, https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Internetnutzer-Note-3-Medienkompetenz, https://www.pisa.tum.de/fileadmin/w00bgi/www/Berichtsbaende_und_Zusammenfassungungen/pisa-2022-nationaler-bericht-berichtsband.pdf, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886925001394?via%3Dihub (Zugriff vom 21.08.2025)
[6] https://www.sofrischsogut.com/post/feed-interrupted-bildpolitiken-des-affekts (Zugriff 25.08.2025)
[7] Forderungen nach einem Schulfach „Medienkompetenz“ äußerte zuletzt auch der Sozialverband Deutschland: https://www.morgenpost.de/politik/article409820964/social-media-co-sozialverband-fordert-neues-schulfach.html (Zugriff 25.08.2025)
Dominik Busch ist Leiter der Abteilung Diskurs & Kommunikation am Zeppelin Museum Friedrichshafen, wo er unter anderem für Digitalität und Strategieentwicklung verantwortlich ist. Zuvor war er Digitalkurator, Informationssicherheitsbeauftragter und Green Officer an der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Strategieentwicklung, der diskursiven, politischen und digitalen Vermittlung, der Rolle von Museen in der Gesellschaft und Potenzialen des Kollektiven als Möglichkeit der Teilhabe und Organisationsentwicklung.
Seit 2023 ist Dominik Busch Vorstandsmitglied von ICOM Deutschland.